In Glehn fand am 21.07.2025 im Dorfgemeinschaftshaus, eine gut besuchte Informationsveranstaltung zur geplanten Errichtung von sechs Windenergieanlagen durch die Firma REA statt.
Anwesend waren unter anderem Bürgermeister Dr. Schick, Vertreter der REA Firmengruppe (mit Sitz in Düren), Herr Blindert (Allgemeiner Vertreter des Landrat) und Herr Bernd Scheipers vom Kreis Euskirchen (untere Immissionsschutzbehörde, Abteilung 60), Herr Schiefer (Stadtplaner), sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Moderiert wurde die Veranstaltung durch Manni Lang.
Bürgerinitiative übergibt Unterschriften
Gleich zu Beginn überreichte Hubert Braun für die Bürgerinitiative „Gegen Wind“ eine Liste mit 332 Unterschriften – das entspricht etwa 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung über 18 Jahren in Glehn. Die Botschaft war deutlich: Die Mehrheit der Menschen vor Ort lehnt das Vorhaben in seiner aktuellen Form ab.
Rechtlicher Rahmen und Genehmigungsverfahren
Zentrale rechtliche Grundlagen für das Projekt sind § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sowie § 9 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Letzterer schreibt ein sogenanntes gebundenes Verfahren vor: Wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, muss die Genehmigung erteilt werden. Die Genehmigung erfolgt auf zwei Ebenen – einer sachlichen Prüfung und einer formalen Prüfung.
Zusätzlich gelten das Wind-an-Land-Gesetz sowie das Windenergieflächenbedarfsgesetz, welche die Ausweisung von Vorrangflächen und den beschleunigten Ausbau von Windenergieanlagen vorsehen.
Artenschutz und Umweltprüfung
Ein zentraler Punkt war der Artenschutz. Für das Vorhaben wurde eine Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Diese kommt unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen zu dem Ergebnis, dass das Projekt zulässig ist. Konkret bedeutet das unter anderem: Zum Schutz von Fledermäusen werden die Anlagen in der Dämmerung – also zu Beginn der Nacht – temporär abgeschaltet, vor allem zwischen April und Oktober.
Auch andere Arten, wie etwa der Rotmilan, seien in Stellungnahmen berücksichtigt worden. Es werde geprüft, welche Arten betroffen sind und inwieweit ihre Lebensräume beeinträchtigt würden. Die notwendigen Kartierungen und Stellungnahmen sind Teil des Verfahrens.
Herr Blindert wies darauf hin, dass die Anforderungen an Umweltgutachten in den vergangenen Jahren deutlich reduziert wurden. Einzelfallprüfungen ersetzen heute viele der früher notwendigen Großgutachten. Man gehe im aktuellen Fall von einem vergleichsweise geringen Risiko aus.
Lärm, Schattenwurf und technische Steuerung
Hinsichtlich Lärm- und Schattenemissionen wurde mehrfach betont, dass die heutigen Windkraftanlagen mit einer Vielzahl an Steuerungsmöglichkeiten ausgestattet seien – bis zu 20 verschiedene Betriebsmodi sind möglich. So kann bei Bedarf ein schalloptimierter Nachtbetrieb aktiviert werden. Der gesetzlich erlaubte Schattenwurf liegt bei maximal 8 Stunden pro Jahr und höchstens 30 Minuten pro Tag je Immissionspunkt – wird dieser Wert erreicht, muss und wird die Anlage automatisch abgeschaltet werden.
Auch nach Inbetriebnahme können Beschwerden gemeldet werden. Die Kreisverwaltung bestätigte, dass nachträgliche Messungen durchgeführt werden können, sollte es Hinweise auf unzulässige Lärmbelastungen geben.
Beteiligung und wirtschaftliche Effekte
Die Veranstaltung thematisierte auch die geplante Bürger- und Gemeindebeteiligung. Die REA stellte zwei Modelle vor:
1. Kommunale Beteiligung nach § 6 EEG: Die Stadt erhält 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde, sofern sie im Umkreis von 2,5 Kilometern zur Anlage liegt – ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme.
2. Private Bürgerbeteiligung: Bereits ab 500 Euro sollen sich Bürgerinnen und Bürger finanziell an den Anlagen beteiligen können – niedrigschwellig und freiwillig.
Darüber hinaus fließt die Gewerbesteuer an den Standort der Anlage. Auf Nachfrage bezifferte REA den erwarteten Stromertrag auf ca. 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und pro Windrad. Bei einer Vergütung von (Marktpreis zum Zeitpunkt des Abschlusses) rund 8–8,5 Cent pro Kilowattstunde würde das einem Umsatz von etwa 1,2 Millionen Euro jährlich pro Anlage entsprechen – über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren.
Eine 100-prozentige Einspeisung sei jedoch nicht garantiert, da die Anlagen auch auf Marktpreise und Netzkapazitäten reagieren. Die Notwendigkeit von Stromspeichern sei langfristig gegeben, aber aktuell noch im Aufbau.
Rückbau, Haftung und Infrastruktur
Angesprochen wurde auch die Frage nach Sicherheit, Haftung und Rückbau. Der Betreiber – also REA – sei verpflichtet, eine Rückbauverpflichtung abzusichern. Dafür werde eine Bürgschaft hinterlegt, die im Insolvenzfall greift. Rückgebaut würden dann sowohl Fundament als auch alle oberirdischen Anlagenteile.
Auf Sorgen über beschädigte Wege durch Bauarbeiten antwortete REA, dass die Wege nach Fertigstellung wiederhergestellt oder sogar verbessert würden – dies werde durch ein Gutachten geprüft.
Die Anbindung ans Stromnetz erfolgt über unterirdische Kabel, ergänzt durch ein kleines, umzäuntes Umspannwerk.
Zum Thema Abrieb von Rotorblättern (Stichwort GFK, Glasfaserabrieb) räumten die Vertreter ein, dass es derzeit keine verbindlichen Vorschriften gebe. Der Gesetzgeber stuft diese Problematik bislang als nicht kritisch ein – was bei Teilen des Publikums auf deutliche Skepsis stieß.
Optik und Auflagen
Ein Bürger forderte, auf ein „rotes Maschinenhaus“ zu verzichten. Dies sei jedoch nicht möglich, so REA, da bei Bauhöhen über 100 Meter laut Luftfahrtbehörde eine entsprechende Farbkennzeichnung verpflichtend sei.
Das Thema nächtlicher Blinklichter wurde ebenfalls angesprochen. Diese seien heute radar- bzw. bedarfsgesteuert und würden nur noch aktiviert, wenn sich ein Flugobjekt nähert.
Emotionale Reaktionen und politische Einordnung
Im Laufe der Veranstaltung kam es mehrfach zu emotionalen Wortmeldungen, Unterbrechungen und offenen Konfrontationen. Ein Bürger verlangte eine schriftliche Garantie, dass er keine gesundheitlichen Schäden durch die Anlagen erleiden werde – was von den Behörden zurückgewiesen wurde, da rechtlich keine solchen Zusicherungen möglich seien.
Auch die politische Dimension der Standortauswahl wurde diskutiert. Bürgermeister Dr. Schick erläuterte, dass bereits vor über 20 Jahren in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung drei kleinere Windvorrangflächen ausgewiesen worden seien – damals mit 1000 Metern (heute gilt ein Mindestabstand von 700 Metern) zur nächsten Wohnbebauung. Flächen seien somit seit langem bekannt – auch der Firma REA. „Wenn wir ehrlich sind“, so Schick, „selbst wenn wir heute neue Flächen im Stadtgebiet suchen würden – sie wären vermutlich schon längst im Regionalplan verplant.“
Einige Teilnehmer kritisierten die Informationspolitik der Stadt. Ein Bürger fragte, warum er nicht bereits vor acht Jahren informiert worden sei. Stadtplaner Schiefer antwortete, man habe versucht, das Thema über sogenannte Konzentrationszonen für Windkraft zu steuern.
Fazit
Die Veranstaltung machte deutlich: Der Widerstand in Glehn ist groß, die Sorgen zahlreich – insbesondere im Hinblick auf Gesundheit, Umwelt und Eigentum. Dennoch ist der rechtliche Rahmen eindeutig: Wenn die Voraussetzungen nach EEG und BImSchG erfüllt sind, ist eine Genehmigung zu erteilen.
Die Stadt betonte, dass sie sich – sollte das Vorhaben nicht zu verhindern sein – zumindest an den finanziellen Effekten beteiligen möchte, um der Region einen Ausgleich zu verschaffen. Wie es nun weitergeht, hängt maßgeblich von der abschließenden Genehmigungsentscheidung des Kreises und der Bezirksregierung ab.
Verfasst von Nathalie Konias








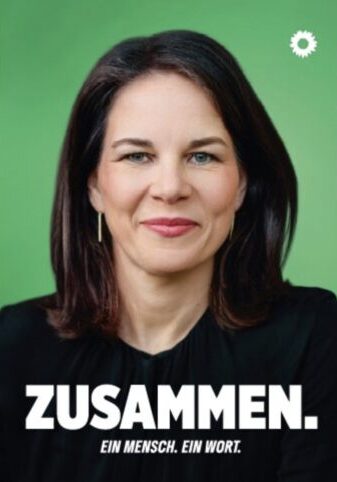
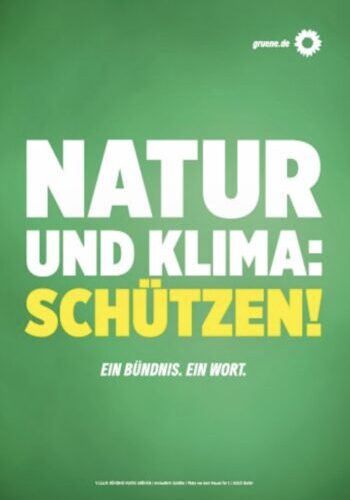

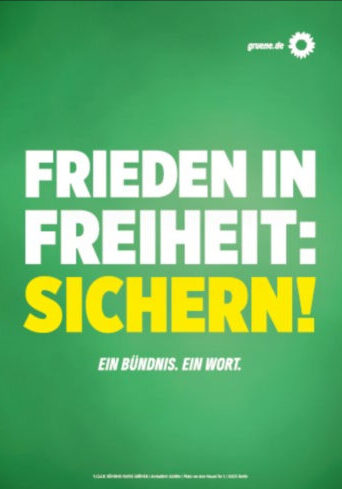
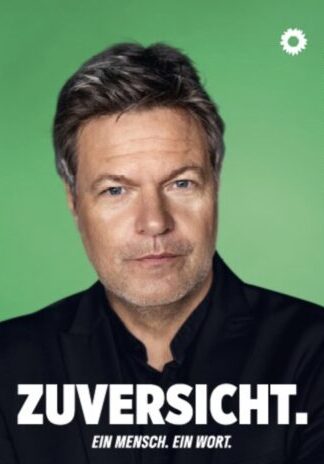
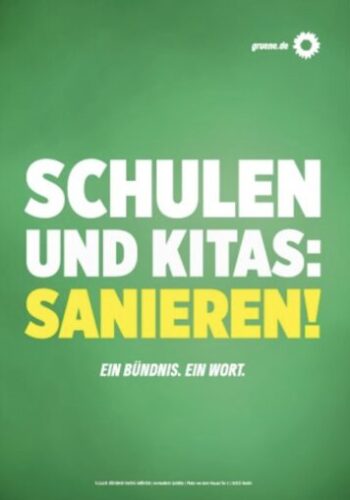
Verwandte Artikel
Grüne Mechernich stellen Reserveliste für Kommunalwahl 2025 auf
Nach einem turbulenten Prozess, steht sie nun fest:Die neue Reserveliste der Grünen Mechernich für die Kommunalwahl am 14. September 2025. Aufgestellt wurde ein vielfältiges, motiviertes Team mit einer gelungenen Mischung…
Weiterlesen »
Offener Grüner Treff
Am 8. Mai 2025 starten wir in die neue Saison mit unserem offenen Grünen Treff im Biergarten Mühlenpark in Mechernich. Und dies immer am ersten Donnerstag im Monat um 19…
Weiterlesen »
Haushaltsrede 2025
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich bei den Mitarbeiter*innen der Kämmerei für die Aufstellung des Haushaltes 2025. Der Haushalt einer Kommune…
Weiterlesen »